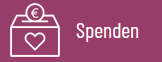Erfahrungsberichte - Begleitung zu Hause
Erfahrungsbericht: Vernetzte Hospizarbeit
Nachdem mein schwer krebskranker Bruder 2019 in ein Pflegeheim in Heppenheim einzog, wurde mir von der Pflegedienstleitung der Kontakt zum Hospiz-Verein Bensheim angeraten. Sofort nach der telefonischen Kontaktaufnahme kümmerte sich die Koordinatorin des Vereins auch um eine Verbindung zum Palliativteam, das dann dafür sorgte, dass sich die für meinen Bruder verbleibende Lebenszeit so schmerzfrei wie möglich gestaltete. Meine Ansprechpartnerin im Hospiz-Verein kümmerte sich auch um einen Platz im stationären Hospiz Bensheim. Leider ist mein Bruder jedoch zwei Tage vor dem angedachten Einzug verstorben.
2023 war dann ein anderer Bruder in Not. Nach jahrelanger Chemobehandlung war er trotz mobilem Pflegedienst nicht mehr in der Lage, allein zuhause zurechtzukommen. Dieses Mal nahm ich gleich Kontakt zum Hospiz-Verein auf. Da mein Bruder aber im Ried wohnte, konnte dieser nicht direkt für ihn tätig werden, denn der Hospiz-Verein Bensheim ist nur für den Großraum Bergstraße zuständig. Man gab mir jedoch die Empfehlung, mich an PaHoRi in Bürstadt zu wenden. Noch am Tag meines Anrufes stand die dortige Hauptamtliche abends am Bett meines Bruders und leitete auch hier den Besuch des Palliativteams in die Wege. Dieser Termin fand gleich am nächsten Tag statt - leider mit dem Ergebnis, dass nur noch der schnellstmögliche Einzug in ein stationäres Hospiz empfohlen werden konnte. Noch vor Ort führte der Arzt einige Telefonate und durch Zufall, Fügung oder wie immer man es bezeichnen will, konnte mein Bruder aufgrund seiner, durch die Onkologie bescheinigten, geringen Lebenserwartung in das stationäre Hospiz Bergstraße einziehen.
Eigentlich wollte er „bis zum Schluss" in seiner Wohnung bleiben. Jedoch am zweiten Tag seines Aufenthaltes im Hospiz sagte er: „Was Besseres hätte mir nicht passieren können!“ Weitere drei Tage später verstarb er - auch für das Pflegeteam überraschend - in meinem Beisein.
Mein persönliches Fazit: Hospiz-Verein, Palliativ-Team und stationäres Hospiz in Bensheim sind drei Rädchen, die gut aufeinander abgestimmt sind. Sie unterstützen nach Kräften die Schwerkranken und die Angehörigen. Die Zusammenarbeit mit Nachbarorganisationen läuft problemlos. Die IBAN des Spendenkontos steckt bei mir an der Pinwand.
HJF
Aus Dankesschreiben von Angehörigen
- Ein großes Dankeschön! Sie an unserer Seite zu wissen, auf dem bangen Weg des Abschieds von Helmut tat einfach nur gut. Trotz der Schwere der Krankheit hat ihre liebevolle, fröhliche Art uns durch manches Tief geholfen. On top natürlich Ihre stets guten Tipps menschlich wie auch medizinisch.
- Wir möchten uns bei Ihnen sehr herzlich bedanken für die sehr hilfreiche Unterstützung während der letzten Lebenstage unserer Mutter. Sie gaben uns wertvolle Tipps für die Nahrungsaufnahme und Hinweise zur Pflege in den letzten Lebenstagen. Dies gab uns Kraft und Durchhaltevermögen. Auch die Urenkel konnten dank ihres Gespräches mit uns liebevoll Abschied von ihrer Uroma nehmen. Sie bemalten Steine und legten diese bei der Urnenbeisetzung ganz stolz auf das Grab der Uroma. Eine Erinnerung für das ganze Leben.
- Ganz herzlichen Dank für die große Hilfe bei Karl. Dieser Abschied macht das Weiterleben leichter, denn wir sind in Frieden mit der Situation. Dafür bedarf es einer Grundlage, die haben wir mit Eurer Hilfe bekommen.
Gudrun: Wenn der Tod auf sich warten lässt - Erinnerung von Angela Schäfer-Esinger, Koordinatorin
Es ist schon eine Weile her, dass ich Gudrun kennengelernt habe. Eine ganz besondere, außergewöhnliche, schillernde Persönlichkeit, viel jünger wirkend als sie in Wirklichkeit ist. Eine Patientin, wie sie mir noch nie begegnet ist. Zwischen uns war direkt eine Verbindung. Ihr Weg und ihr Umgang mit der schweren
Erkrankung ist für mich besonders inspirierend und bewegend.
Gudrun hat eine ganz eigene Art, mit ihrer Erkrankung umzugehen. Sie ist auf einem äußerst langen, steinigen Weg unterwegs, wartet seit zwölf Monaten darauf, dass sie stirbt, aber das passiert nicht. Trotz allem Hadern – sie findet immer wieder ihren eigenen Umgang, schafft sich durch – bleibt sie bis heute diese außergewöhnliche Persönlichkeit.
Nach ihrer ersten, überstandenen Krebserkrankung vor vielen Jahren krempelt sie ihr Leben noch einmal völlig um, fokussiert sich bewusst auf Freude, Spaß, Genuss in allen Lebensbereichen. Keine Selbsthilfegruppe, nicht Schicksalsgemeinschaft sein mit Menschen ihres Alters, „die nur jammern“, so sagt sie. Nein. Sie will das Leben nach der Heilung auskosten. „Ich habe mir ein schickes Cabrio gekauft, die Nase in den Wind gestreckt und das Leben genossen!“ Dieser lebensfrohe Fokus ist ihr persönlicher Weg. Und sie bekommt ein paar wundervolle Jahre geschenkt.
Doch dann kommt der Krebs zurück, mit immenser Wucht, als existenzielle Bedrohung. Und diesmal zeigt er ein anderes, unerbittliches Gesicht. Stück für Stück muss Gudrun an die Krankheit abgeben, vieles von dem, was sie ausmachte, was sie liebte, loslassen: als schöne Frau wahrgenommen werden, Komplimente für ihr gepflegtes Erscheinungsbild, für ihren wunderschönen Körper zu bekommen, über den sie sich einst auszudrücken vermochte. Und nun: im Gesicht aufgedunsen von Medikamenten und Operationen, durch Schlafmangel geschwächt und von Schmerzen geplagt. Der Blick in den Spiegel wird ihr fremd. Zunächst ist sie ans Haus gebunden, später an den Toilettenstuhl, nun an das Bett. Welch eine Erniedrigung, so empfindet sie es. Die Freiheit, die Selbstbestimmung unwiderruflich weg.
Doch lange Zeit behält sie ihren Humor und ihre ganz eigene Art. Bunt und irgendwie immer sonnig ihr Krankenzimmer, Musik im Raum, Glanzleggins und Glitzerpulli – und statt eines Eimers für drohendes Erbrechen steht ein Champagnerkübel unter dem Bett.
Nur das von ihr so geliebte bunte Leben, das findet draußen statt, ohne sie, und damit mag sie sich so gar nicht versöhnen. „Was ist das für ein Leben?“, fragt sie mich. „Ich kann nicht mehr tanzen, schäme mich für mein Äußeres, mag nicht mehr in die Öffentlichkeit gehen, bin mir selbst fremd geworden. Wozu also noch leben?!“ Als hätte jemand die Gardine geschlossen, bleibt das Licht, die Freude nun und fortan draußen.
Eines Tages formuliert sie es klar und deutlich: „Ich will und ich kann so wirklich nicht mehr!“ Sie scheint bereit für den Tod. Ihre Beerdigung hat sie bis ins Detail geplant. Die Vergangenheit im Geiste immer wieder durchgearbeitet auf Themen, die noch offen sein könnten. So liegt sie nun im Bett, seit Tagen, Wochen, Monaten. Wartend, den Blick zur Decke gerichtet. Verzweifelt und schmerzgeplagt, ruhelos, strauchelnd. Keine Kraft zum Gehen, zum Reden, selbst fernsehen ist nicht mehr möglich. Wenige Besuche lässt sie noch zu. Und das Gefühl, nicht sterben zu können – zu dürfen, wird ihr Leitgedanke.
Nach jedem Besuch bei ihr verabschiede ich mich und denke, es könnte das letzte Mal gewesen sein. Und doch ist sie immer noch unter uns. Komme ich zu ihr, bittet sie mich jedes Mal um meine professionelle Einschätzung: „Und, was sagst du als Fachkraft, sehe ich jetzt sterbend aus? Hat sich was an mir verändert seit unserem letzten Treffen? Werde ich es endlich bald geschafft haben?“ Nicht leicht, ihr dann behutsam zu vermitteln: „Du, ich muss Dich enttäuschen, ich glaube, Du musst noch Geduld haben.“
Sie fleht mich immer wieder mal an, ob ich nicht etwas tun kann. „Bitte hilf mir!“ Zum Leben zu wenig, zum Sterben zu viel. Ehemann, Kinder, Enkelkinder, beruflicher Erfolg, viele Freundschaften, alles da. Alles erlebt. „Es ist nun gut, ich will gehen, ich bin schwer krank, viele Symptome, doch warum darf ich nicht gehen? Was, um Himmels Willen, habe ich verbrochen, dass das nicht enden will?“
Gudrun zeigt uns: Wir haben nicht alles in der Hand. Und wir kommen nicht umhin, mit dem umzugehen, was das Leben – das Schicksal, Gott, unser Karma oder wo auch immer wir es für uns verorten – uns anbietet.
Ich wünsche ihr, dass sie bald sterben kann. Ihre Not kann ich so gut verstehen! Ich erkenne mich in ihr: Auch ich liebe das Leben, will es auskosten, meine Freiheit genießen, selbstbestimmt, voller Lebendigkeit und Offenheit für neue Erfahrungen und Abenteuer! Das verbindet uns. Und lässt mich auch über mich selbst nachdenken: Wie wird es mir einmal ergehen? Wie würde ich in dieser Situation empfinden, wie diese schier unmenschliche Herausforderung bewältigen? Verrückt, wie wir ganz am Ende unseres Lebens nochmal vor solch schwierige, ungeahnte Aufgaben gestellt werden.
Zu Gudrun habe ich ein Bild vor meinem inneren Auge: Sie steht an einer Bushaltestelle, wartend. Leute steigen ein, Leute steigen aus. Es regnet, stürmt, ist ungemütlich. Und jedes Mal, wenn ein Bus vorfährt, hat er für sie keinen Platz, die Türen schließen sich vor ihrer Nase. Es ist für sie noch nicht an der Zeit. Obwohl sie nichts versäumt hat, nichts steht noch aus. Da ist kein Konflikt, der noch bearbeitet werden will, kein Abschied, der noch ausgesprochen werden soll, kein liebes Wort, das nicht schon gesagt worden wäre. Wenn wir überhaupt von letzten Hausaufgaben am Lebensende sprechen wollten, so gilt für sie: Gudrun hat ihre Aufgaben vorbildlich erledigt! Und doch, der Tod lässt sie grausam warten.
Und ich? Stelle mich an ihre Seite, warte mit ihr an der Bushaltestelle und halte ihr Warten, ihre Verzweiflung mit aus. Auch wenn es kalt, regnerisch, ungemütlich ist: Wir lassen sie nicht allein. Einsteigen wird sie dann alleine.
Kämpferinnen an meiner Seite
Als ich die Diagnose erhalten habe, wusste ich zunächst nicht wirklich etwas damit anzufangen. ALS- eine schnell voranschreitende Erkrankung des zentralen Nervensystems, bei der Nervenzellen, die für die Bewegung von Muskeln zuständig sind, schrittweise absterben. Soweit die klinisch sterile Definition.
Tausend Fragen strömten durch meinen Kopf. Würde ich schon bald im Rollstuhl sitzen? Wäre ich gelähmt, könnte mich nicht mehr mitteilen? Würde ich letztendlich ersticken? Ich hatte Angst. Große Angst vor dem was kommen würde. Und gleich danach überkam mich ein Gefühl der Verzweiflung. Immerhin habe ich eine Tochter, ein Enkelkind, eine Mutter, die irgendwann auf meine Unterstützung und Pflege angewiesen sein wird. Ich kann nicht nicht funktionieren, ich werde gebraucht!
Zusätzlich hatte gerade mein Ruhestand begonnen. So lange hatte ich mich darauf gefreut, etwas mehr Zeit zu haben, zum Reisen, zum Seele baumeln lassen, zum Dasein für andere. Stattdessen nimmt der Krankheitsverlauf rasant Fahrt auf, die Lähmung breitet sich zunächst in meinem Mund, der Zunge und der Kaumuskulatur aus. Das Sprechen fällt mir immer schwerer und macht mir die Kommunikation zu Krankenkassen, Behörden und Therapeuten fast unmöglich.
Zum Glück habe ich eine Kämpferin an meiner Seite. Angela kommt vom HospizVerein Bergstrasse und nimmt mir im Alltag so viele Aufgaben wie möglich ab. Sie ist eine große Stütze, hört mir zu, nimmt sich Zeit und kämpft mit Behörden, wenn mir schon längst die Kraft dazu fehlt. Zum Glück kommt noch eine Ehrenamtliche dazu, die ebenfalls Zeit für mich mitbringt. Ein sehr glücklicher Moment für uns alle. Die beiden kämpfen an vielen Stellen für mich. Versuchen, den Kontakt zu meiner Tochter nach all den Jahren wieder enger zu machen. Trösten meine Mutter, wenn sie vor Sorge um ihr eigenes Kind fast den Mut verliert. Alles Aufgaben, die ich eigentlich gerne übernehmen möchte. Aber ALS lässt mir dafür keine Kraft.
Es gibt noch so viel, um das ich mich kümmern möchte. Ich schmiede Pläne, am übernächsten Tag möchte ich, dass alles vorbei ist. Aber ich möchte noch sehen, wie mein Enkel groß wird. Ich bin noch nicht bereit zu gehen. Der Vorschlag ins Hospiz zu gehen, hört sich im ersten Moment für mich fast lächerlich an. Hospiz? Wofür denn? Ist das nicht für Menschen, die bald sterben? Der Gedanke daran braucht Zeit und eine große Portion Mut, denn ich muss einsehen und verstehen, dass ich es bin, die bald sterben wird. Der Umzug ins Hospiz tut weh, gibt gleichzeitig auch Hoffnung auf Rückhalt und Unterstützung. Alle begrüßen mich mit offenen Armen und ich verliere ein wenig die Furcht. Meine beiden Kämpferinnen sind auch jetzt noch eng an meiner Seite und begleiten mich durch meine letzten Tage.
Maria, Patientin der ambulanten Hospizarbeit